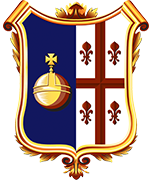Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Der schaut aber verklärt drein! Wenn man das von jemandem sagt, dann ist es nicht gerade ein Kompliment. Man möchte damit sagen, dass er ein bisschen abgehoben ist, dass er nicht wirklich in der Realität seinen Platz findet, vielleicht sogar, dass er ein kleines bisschen getrunken hat; jedenfalls ist er weit von dem entfernt, was wir die Wirklichkeit nennen und vielleicht sogar ein Träumer.
Das aber hat nichts mit der Verklärung unseres Herrn zu tun! Der Herr, wie wir gerade gehört haben, sieht tatsächlich verklärt aus, aber diese Verklärung bringt Ihn nicht weg von der Wirklichkeit, sondern lässt die eigentliche, göttliche Wirklichkeit in Ihm nach außen sichtbar werden, sodass Er klar und leuchtend erscheint und Seine Kleider weiß wie Schnee. Diese Verklärung offenbart das wahre Sein des Herrn, der ganz Mensch ist, sodass Ihn niemand zunächst als den Sohn Gottes erkennen kann, aber auch ganz Gott, was in diesem Moment sichtbar wird.
Trotzdem können wir fragen: Was hat das mit uns zu tun? Ist es nicht immer noch abgehoben, ist es nicht immer noch fern von unserer Alltäglichkeit? Solchen Fragen zeugen von wenig Verständnis für die Wirklichkeit des Christen, denn diese umfasst die Verklärung durch die Gnade: Auch wir sind nämlich anfanghaft verklärt! Wir bleiben Menschen, aber wir haben das Geschenk der Teilhabe an der göttlichen Natur erhalten und zwar durch das übernatürliche Geschehen der Rechtfertigung, wie die Kirche die göttliche Rettung des Sünders nennt.
Die Rechtfertigung, so lehrt das Konzil von Trient, ist die Versetzung aus dem Zustand der Sünde, in den jeder Mensch durch die Sünde des ersten Adam hineingeboren wird, in den Zustand der Gnade und Gotteskindschaft durch die Verdienste des zweiten Adam Jesus Christus, unseres Erlösers. Wir alle sind im Moment der Taufe gerechtfertigt worden. Wenn der Priester dem Kind das Wasser über die Stirn laufen lässt und den Namen des Dreifaltigen Gottes über es anruft, wird Gott selbst in diesem Kind rechtfertigend tätig und die verklärende Gnade der Gotteskindschaft im Zeichen der Taufe sichtbar.
Diese anfanghafte Verklärung, die Rechtfertigung und Begnadung, die in der Taufe mit uns allen vor sich gegangen ist, hat zwei Hauptelemente: Zunächst einmal wird die Erbsünde weggenommen und unsere Natur gereinigt. Dazu wird uns noch die heiligmachende Gnade mit dem Geschenk der Gotteskindschaft verliehen. Im zweiten Petrusbrief heißt es, wir werden θείας κοινωνοὶ φύσεως, divinae consortes naturae (2 Petr 1, 4), wir werden teilhaft der göttlichen Natur. Wir stehen nicht mehr als Sünder vor Gott, weil die Sünde ganz weggenommen und nicht nur zugedeckt wurde. Zusätzlich werden wir innerlich erneuert, wir erhalten eine innere Kraft, die uns ermöglicht, von nun an als Gotteskinder zu leben, von nun an anfanghaft innerlich verklärt zu sein, von nun an als Menschen an der Natur Gottes teilzuhaben, die uns ein ganz neues Leben gibt.
Das bewirken wir nicht selbst, es ist nicht das Ergebnis einer äußerlichen moralischen Anstrengung, nichts, das wir in irgendeiner Weise selbst hervorrufen könnten. Die Rechtfertigung ist das Tun des barmherzigen Gottes an uns, durch das uns die Verdienste Jesu Christi am Kreuz erlösend erreichen. Gott selbst stellt dadurch in uns Seine Ehre wieder her, er erneuert sein Bild in uns und eröffnet uns damit den Weg zum ewigen Leben. Das ist der Grund, warum die Rechtfertigung notwendig ist, denn ohne gerechtfertigt zu sein, können wir nicht in der Ewigkeit vor Ihm stehen und Ihn preisen. Die Verdienste Jesu Chrisi sind es, die dieses Wunder der anfanghaften Verklärung in uns bewirken, und es ist die Barmherzigkeit Gottes, die ohne Ansehung unserer Verdienste uns dieses Geschenk gibt, damit wir in dem leben können, was uns geschenkt worden ist, nämlich in der innerlichen Heiligkeit der Gnade und in der Gotteskindschaft, die die Einwohnung des hl. Geistes in unserer Seele mit sich bringt.
Die heiligmachende Gnade wirkt innerlich und verändert unser Sein. Die Rechtfertigung, durch den Heiligen Geist in uns bewirkt, ist also nicht etwas Äußerliches, das nur moralisch für uns einen Wert hat. Gott ist nicht nur wie ein Gesetzgeber, der von außen Lehren und Vorschriften erlässt, sondern Er ist auch wie ein Arzt, der uns als gesundmachende Medizin die innere Kraft gibt, die uns von der Sünde heilt und zum guten Handeln innerlich befähigt. Die heiligmachende Gnade ist jenes Element göttlicher Stärke, das uns ermöglicht, das zu tun, was Er zu unserem Heil will. Gott gebietet nicht nur und lässt uns dann allein, sondern Er schenkt uns jene Gabe, mit der wir tun können, was Seines Willens ist.
Diese heiligmachende Gnade ist eine bleibende Kraft in uns. Die Theologie nennt sie einen habitus entitativus, eine in unserem innersten Sein wirkende dauernde Kraft, die uns nicht mehr verlässt, solange wir grundsätzlich mit Gottes Willen in Übereinstimmung leben und keine Todsünde begehen. Sie wird jedesmal gestärkt, wenn wir zur Beichte gehen, und sie wird uns wieder neu geschenkt, wenn wir nach einem schweren Fall Buße tun und in der heiligen Beichte von Herzen bereuen, was wir getan haben. Die Gnade der Rechtfertigung zusammen mit der bleibenden Gnade der Heiligung gibt uns die Stärke, als Christen zu leben. Deswegen sagt der Apostel Paulus so deutlich: „Gottes Wille ist eure Heiligung“ (1 Tim 4, 3). Dieser Heiligungswille Gottes wird uns nicht nur von außen angetragen, sondern erneuert uns innerlich durch die Macht der von ihm ausgehenden Gnade. Die Gnade stärkt unseren eigenen Willen und gibt uns die tatsächliche Möglichkeit zu tun, was Gott will.
Jeder von uns hat diese anfanghafte Verklärung durch die Teilnahme an der göttlichen Natur erhalten. Jeder von uns darf hoffen, wenn er christlich lebt, das Geschenk der heiligmachenden Gnade immer in sich zu tragen, jeder von uns darf im Vertrauen auf diese Gnade, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt und durch die Taufe vermittelt wird, wissen, dass er geheiligt ist. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Anstrengung allein: Mit der geschenkten Gnade müssen wir wohl immer mitarbeiten, doch die Gnade geht allem unserem Tun voraus und begleitet uns auf dem Weg, den sie vollendet. Wir sind niemals allein. Die Kraft Gottes bleibt in uns. Der göttliche Arzt bleibt an unserer Seite und gibt uns von Neuem Seine heiligmachende Medizin, wenn wir durch die Sakramente der Kirche darum bitten.
Deswegen schauen wir nicht verklärt, weit von der Wirklichkeit entfernt, sondern wir sind verklärt, durch die Wirklichkeit Gottes in uns. Jeder von uns kann sicher sein, dass er in der Taufe heilig geworden ist, und seine ganze Aufgabe ist es nun, diese Heiligkeit zu leben und allen zu zeigen, ebenso wie der Herr seine göttliche Wirklichkeit in der Verklärung offenbart. Was wir Gutes tun, geschieht immer mit der Kraft Gottes und aus dieser heraus. Wenn wir es mit ganzem Herzen tun und die uns angebotene Hand der Gnade annehmen, dann wird diese Heiligkeit nach außen sichtbar und alle werden sehen, dass wir schon anfanghaft verklärt sind, und mit Christus in der Heiligkeit, die Gott allein schenkt, für das ewige Leben erwählt. Amen.