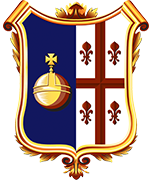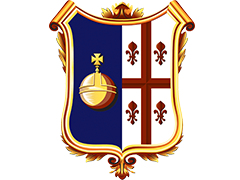Kloster Maria Engelport
Predigt von Msgr. Prof. DDr. R. Michael Schmitz
13. Dezember 2020
Dritter Adventssonntag Gaudete
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
„Tu dir etwas Gutes, nur für dich selbst.“ Dieser dumme Werbeslogan enthält einen inneren Widerspruch. Man kann nämlich sich selbst gar nichts Gutes tun, wenn es ausschließlich und nur für uns selbst ist. Egoismus ist nie etwas Gutes. Der Mensch ist nicht geschaffen, um alleine zu sein. Wir sind nicht auf uns selbst konzentriert, sondern Gott hat uns so gemacht, dass wir auf die Gemeinschaft hin offen sind. Das wahre Glück, die wahre Zufriedenheit, die wirkliche innere Freude entsteht nur, wenn sie unsere Seele, wenn sie unser ganzes Menschsein auf die Gemeinschaft hin öffnet.
Deswegen heißt es schon zu Beginn: „Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei“. „Nach seinem Bild schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau“. (Genesis 1, 27-28). Gott hat uns in diese Welt gestellt als animal sociale – als Gemeinschaftswesen. Wir sind nicht nur für uns selber da, sondern wir sind immer auch für andere da. Wahre Freude ist immer gemeinsam.
Nur die Hingabe an Andere bringt uns die wahre Freude im Herrn, von der es heute heißt, dass wir uns immer ihrer erfreuen sollen: Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete (Philipper 4, 4). Das zeigt sich von Anbeginn unserer Existenz. Wir brauchen die Familie, wir brauchen eine häusliche Umgebung, wir brauchen Freunde, wir brauchen, wenn es unsere Berufung ist, eine Ehe oder eine geistliche Gemeinschaft. Wir brauchen das Zusammensein mit anderen, wo wir uns anderen schenken können, wo wir aber auch empfangen und durch das unsere Freude wächst.
Ebenso so ist es in der größeren Gemeinschaft des Staates. Jeder von uns gibt seinen Teil zum gerechten christlichen Staat hinzu. Wir empfangen von ihm die Ordnung und die Sicherheit, die wir brauchen und die wir alleine nicht schaffen könnten. Wenn wir alleine wären, würden wir auch im weltlichen Bereich einer ständigen Unsicherheit leben. Wenn wir uns nur alleine Gesetze geben würden, dann würden wir unserem eigenen Egoismus dienen, denn wenn wir nicht auf das Große und Ganze schauen, dann vereinzeln und vereinsamen wir.
Das gilt ebenso für die Kirche, denn wir verehren Gott nicht alleine. Christus hat die Kirche, diese übernatürliche, in sich perfekte Gemeinschaft schaffen wollen, damit wir durch ihre Heilsmittel gemeinsam das Heil erlangen. Wir beten gemeinsam, wir wohnen gemeinsam dem Heiligen Opfer bei. Auch Christus hat beim ersten Heiligen Opfer seine Apostel um sich versammelt als ein Abbild jeder größeren Gemeinschaft, für die wir alle geschaffen sind, nämlich die Gemeinschaft der Freundschaft mit Gott.
All diese Dinge nämlich, die Familie, der Freundeskreis, der Staat, die Kirche haben nur dann einen Sinn und bringen nur dann Freude, wenn sie wirklich auf die höhere Gemeinschaft ausgerichtet sind, auf die Gottesfreundschaft, die Christus uns schenkt, indem er uns zu Kindern des Vaters macht. Immer müssen wir durch das rein Menschliche hindurchsehen. Wir müssen uns vor allen Dingen von unserem Egoismus lösen. Nur so können wir in der Familie das Abbild der Heiligen Familie sehen und in der Freundschaft das Abbild der Freundschaft Jesu und Johannes. Nur so können wir in der Gemeinschaft des Staates die Ordnung Gottes wiedererkennen und sie durchsetzen. Nur so erscheint die Gemeinschaft der Kirche uns als die Entsprechung der großen Gemeinschaft des Himmels, in der die Engel und die Heiligen gemeinsam Gott eine ewige und wunderbare Freude darbringen, die von seiner Gnaden in ihrem Inneren kommt.
Weil das so ist, will der böse Feind uns vereinzeln. Er gleicht einem Rudel Wölfe oder Löwen, das jagt und das das Tier, das es reißen will, von der Herde trennt. Wir sind selbstverständlich keine Herdentiere, wir sollen als Christen nicht einfach tun was die Masse tut, aber wir müssen im Schafstall Gottes bleiben. Wir sollen in der Herde Jesu Christi bleiben. Wenn wir merken, dass der Teufel uns durch Starrsinnigkeit, durch Misstrauen, durch Angst, durch Sünde, durch all Versuchungen der Vereinzelung, die er seit alters her anwendet, um uns einsam zu machen, von der Herde abwenden will, dann müssen wir auf der Hut sein. Wir dürfen uns nicht von der Herde Christi abwenden lassen, weil dann unsere Freude zerstört ist. Das nämlich will der Teufel tun: Er will unsere Freude zerstören!
Wir sehen es in unserer Gesellschaft, wir sehen es bei so vielen Zeitgenossen, die sich von der Herde Christi abgewandt haben. Sind sie froher geworden? Sind sie glücklicher geworden? Sind sie zufriedener geworden? Im Gegenteil. Angst, Einsamkeit und vor allen Dingen die Sünde hat sie im Griff bekommen. Sie sitzen oft genug zuhause nur noch vor Fernseher oder Computer, sie sehen keinen anderen mehr und sie sind nicht selten so vereinzelt, dass sie sich gar nicht mehr miteinander unterhalten können, weil sie immer nur auf ihr Handy blicken. Das alles ist der Plan der Vereinzelung, dem Gott und die Gemeinschaft der Kirche entgegenstehen.
Öffnen wir uns daher der Gemeinschaft, wenn wir merken, dass wir aus der Herde ausgesondert werden sollen, die Christus zu unserem Heil gegründet hat. Versuchen wir gegen die teuflische Vereinsamung und den kalten Individualismus mit den Waffen Jesu Christi zu kämpfen, um uns in die Gemeinschaft Gottes zu retten. Versöhnung, Verzeihung, Neuanfang, Barmherzigkeit, Bekehrung, Umkehr, Frieden, und vor allem auch die heilige Beichte sind Mittel, die Christus uns an die Hand gegeben hat, um uns wieder zur Gemeinschaft zurückzubringen. Jede Ehe ist schwierig, jede Familie hat Kreuze zu tragen, jede geistliche Gemeinschaft ist immer wieder von den Schwierigkeiten des täglichen Lebens bedroht, jede Freundschaft ist in Gefahr, wenn sie Christus dient, jedes Staatswesen und auch die Kirche sind bedroht, weil der Teufel die Gemeinschaft Gottes hasst. Deswegen wollen wir dem Aufruf des Apostels Paulus folgen: „Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete“.
Freut euch! Freut euch an der Freundschaft Gottes! Freut euch an der Familie! Freut euch an der Gabe der Ehe! Freut euch an der geistigen Gemeinschaft! Freut euch an der Gemeinschaft der Kirche! Freuen wir uns, trotz der Kreuze und Leiden, die das unweigerlich mit sich bringt, an der Gottesgemeinschaft, damit der Teufel uns nicht in die Einsamkeit treibt, damit er uns nicht zu Opfern eures Egoismus werden lässt, sondern damit unsere Herzen sich weit öffnen für die Freude und Herrlichkeit Christi! Um uns daran zu erinnern lässt uns am heutigen Sonntag Gaudete die Kirche bereits die weihnachtliche Freude vorhersehen. Wir sehen an den rosa Messgewändern der Priester, dass sich das Dunkel erhellt: Christus, der Gemeinschaftsstifter, steht vor der Tür!
Wir sehen, dass der Teufel sein Spiel ausgespielt hat. Wir sehen, dass auch wenn wir versucht werden, uns die Hoffnung niemals verlässt, denn wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine in der Familie, wir sind nicht alleine im Staat, wir sind nicht alleine in der Kirche. Es gibt die Gemeinschaft der Wohlmeinenden, die sich von der dumpfen Masse absondert, die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinschaft der Heiligen! Diese Gemeinschaft kann der Teufel nicht zerstören, denn sie ist auf dem Handeln und Tun des ewigen Hohepriesters Christus gegründet, der uns für immer die Freude gebracht hat. Wenn wir an dieser Gemeinschaft im Glauben festhalten, dann kann der Teufel, der Zerstörer der Freude, kann uns nichts anhaben. Mag uns auch die Traurigkeit der Zeit manchmal in dunkle Stunden bringen, wir wissen, dass die Freude der Herrlichkeit Gottes immer siegt, denn Christus ist Sieger, König und Herr in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.